
Ein Schlaganfall kann jeden treffen – plötzlich, ohne Vorwarnung. Doch schnelle Hilfe kann Leben retten und bleibende Schäden verhindern. PD Dr. med. Timo Kahles, leitender Arzt Neurologie und Co-Leiter des Stroke Centers am Kantonsspital Aarau AG, erklärt, woran man einen Schlaganfall erkennt, was im Notfall zu tun ist – und warum moderne Bildgebung selbst bei unbemerkten nächtlichen Schlaganfällen Leben retten kann.
Herr Kahles, woran erkennt man einen Schlaganfall? Welche Symptome sind besonders alarmierend?
Ein Schlaganfall tritt in der Regel sehr plötzlich auf. Abhängig vom betroffenen Hirnareal sind typische Warnzeichen eine halbseitige Lähmung oder Gefühlsstörung, ein herabhängender Mundwinkel und Sprach- oder Sprechstörungen. Weitere Symptome können Sehstörungen oder Gleichgewichtsprobleme sein. Auch ein plötzlicher heftiger Kopfschmerz – «Donnerschlag» – kann auf einen Schlaganfall hinweisen. Grundsätzlich ist auffällig, wenn Symptome nur auf einer Körperseite auftreten und plötzlich einsetzen – das ist ein wichtiges Alarmsignal.
Welche Typen/Arten von Schlaganfällen gibt es und worin unterscheiden sich diese?
Beim ischämischen Schlaganfall ist ein Blutgefäss im Gehirn verstopft – meist durch ein Blutgerinnsel (Thrombembolus) oder eine Gefässverengung infolge von Atherosklerose. Etwa 85 Prozent aller Schlaganfälle gehören zu dieser Form. Beim hämorrhagischen Schlaganfall hingegen kommt es durch eine Gefässruptur entweder zum Blutaustritt in das Hirngewebe (intrazerebrale Blutung) oder seltener zwischen die Hirnhäute (Subarachnoidalblutung).
Da sich die Symptome beider Formen häufig ähneln, ist eine rasche Bildgebung mittels Computertomografie (CT) oder Magnetresonanztomografie (MRT) zwingend notwendig, um die Ursache eindeutig zu klären. Entscheidend ist diese Unterscheidung auch für die Behandlung. Die feinen, aber therapeutisch entscheidenden Unterschiede unterstreichen die Bedeutung spezialisierter Schlaganfallzentren (Stroke Units und Stroke Centers), in denen eine strukturierte Abklärung – von der klinischen Untersuchung bis zur hochauflösenden Bildgebung – innerhalb kürzester Zeit erfolgt. Jede Minute zählt, und der frühzeitige Transport durch den Rettungsdienst (Notruf 144) in ein geeignetes Zentrum kann über Leben, Funktion und Lebensqualität entscheiden.
Warum ist gerade bei einem Schlaganfall die Zeit ein so entscheidender Faktor?
Zeit ist bei einem Schlaganfall ein kritischer Faktor. Beim ischämischen Schlaganfall, bei dem ein Blutgefäss verstopft ist, kommt es zur Minderversorgung des dahinterliegenden Hirngewebes mit Sauerstoff und Nährstoffen, und das Gewebe beginnt abzusterben. Je schneller das verschlossene Gefäss wieder geöffnet wird, desto grösser die Chance, dass das betroffene Gehirngewebe gerettet werden kann. Beim hämorrhagischen Schlaganfall ist die Zeit entscheidend, um ein weiteres Wachsen der Blutung zu verhindern bzw. bei einer grossen Blutung eine rasche Entlastung zu evaluieren.
(BE-)FAST-Test zur Erkennung eines Schlaganfalls
- «B» für Balance – also Gleichgewichtsstörungen, Schwindel
- «E» für Eyes –ein- oder beidseitige Sehstörungen, Doppelbilder
- «F» steht für Face – also Gesicht: ein einseitig herabhängender Mundwinkel beim Versuch zu Lächeln
- «A» für Arm – ein Arm sinkt ab beim Versuch, beide Arme anzuheben
- «S» steht für Speech – also Sprache/Sprechen. Schwierigkeiten beim Sprechen oder Verstehen
- «T» für Time – denn Zeit ist entscheidend
Was sollte man als Ersthelfer tun, wenn man den Verdacht auf einen Schlaganfall hat?
Das Allerwichtigste ist, sofort den Notruf 144 zu wählen, damit die spezifische Diagnostik und Behandlung rasch erfolgen kann. Als Ersthelfer sollte man zudem prüfen, ob die betroffene Person bei Bewusstsein ist, ob sie normal atmet und der Herzschlag vorhanden ist. Wenn die Person bewusstlos ist, bringt man sie in die stabile Seitenlage. Wichtig ist auch: keine Getränke oder Nahrung geben – und keine gerinnungshemmenden Medikamente wie beispielsweise Aspirin zu verabreichen.
Warum sollte man Aspirin nicht verabreichen?
Ohne Bildgebung kann man nicht sicher unterscheiden, ob eine Blutung oder ein Gefässverschluss vorliegt. Bei einem hämorrhagischen Schlaganfall, also einer Hirnblutung, kann Aspirin die Situation erheblich verschlimmern, da es die Blutgerinnung hemmt.
Sollte man eine Schlaganfallpatientin oder -patienten in eine bestimmte Position bringen oder beispielsweise etwas zu trinken geben?
In der Regel lässt man die Person in Rückenlage. Bei Erbrechen oder Bewusstlosigkeit sollte man sie in die Seitenlage bringen; bei akuten Herzproblemen/Atemnot auch halbsitzend. Wichtig ist, keine Panik zu verbreiten und die Person zu beruhigen – das kann helfen, etwaige Atemprobleme zu mindern. Auf die Gabe von Flüssigkeit oder Nahrung sollte verzichtet werden, u.a. da es nicht selten zu Schluckproblemen bei den Betroffenen kommt.
Welche Rolle spielen Blutverdünner in der Akutbehandlung?
Bei ischämischen Schlaganfällen – also solchen, die durch ein verstopftes Blutgefäss im Gehirn verursacht werden – ist die sogenannte intravenöse Thrombolyse ein zentraler Bestandteil der Akutbehandlung. Dabei wird innerhalb von viereinhalb Stunden nach Symptombeginn ein gerinnselauflösendes Medikament in eine Vene verabreicht, um die Durchblutung im betroffenen Hirnareal möglichst rasch wiederherzustellen.
Bei Verschlüssen grösserer Hirnarterien kann innerhalb von acht Stunden nach Symptombeginn zusätzlich oder alternativ ein endovaskulärer Eingriff über einen Hirnkatheter erfolgen.
In Stroke Units und Stroke Centers können wir durch spezielle Schnittbilder des Gehirns auch Patientinnen und Patienten ausserhalb des starren Zeitfensters von viereinhalb bzw. acht Stunden oder mit unbekanntem Einsetzen der Symptome identifizieren, welche von einer Akutbehandlung profitieren können.
Wie hoch ist das Risiko für einen weiteren Schlaganfall?
Etwa jede achte betroffene Person erleidet innerhalb von fünf Jahren einen zweiten Schlaganfall – das Risiko ist besonders hoch im ersten Jahr nach dem Ereignis. Deshalb sind Nachkontrollen nach drei Monaten und nach einem Jahr üblich, um ein Fortschreiten einer Atherosklerose der hirnversorgenden Arterien, bestimmte Herzrhythmusstörungen wie ein Vorhofflimmern und die optimale Einstellung der Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Cholesterin oder Rauchen zu kontrollieren. Hier ist die enge Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen insbesondere der Hausarztmedizin und Kardiologie wertvoll und wichtig.
Auch leichte Schlaganfälle oder transitorisch ischämische Attacken (TIAs) – also vorübergehende Durchblutungsstörungen ohne bleibende Schäden – sind Warnzeichen und müssen genauso ernst genommen und umfassend abgeklärt werden. Sie bieten ein wichtiges Zeitfenster zur Prävention schwererer Ereignisse und sollten ebenfalls konsequent in spezialisierten Zentren diagnostiziert und behandelt werden.
Wie kann man einem Schlaganfall vorbeugen?
Im Fokus steht hier zum einen die optimale Einstellung vaskulärer Risikofaktoren, zum anderen die gezielte Behandlung spezifischer Ursachen.
Im Gegensatz zu den nicht-modifizierbaren Risikofaktoren wie beispielsweise Alter, Geschlecht, genetische Veranlagung und ethnische Herkunft sind die optimale Einstellung der beeinflussbaren Risikofaktoren insbesondere eines Bluthochdrucks und das Sistieren eines Nikotinkonsums entscheidend zur Prävention eines Schlaganfalls. Darüber hinaus wichtig ist das Einstellen eines Diabetes mellitus und hoher Cholesterinwerte sowie die Reduktion eines Alkoholüberkonsums. Auch regelmässige körperliche Aktivität – bereits tägliches Spazierengehen oder moderates Ausdauertraining – und eine ausgewogene, bevorzugt mediterrane Ernährung tragen wesentlich zur Risikoreduktion bei. Letztere zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, ungesättigten Fettsäuren (z.B. aus Olivenöl oder Nüssen) und wenig rotem Fleisch aus. Studien zeigen, dass durch die Kombination dieser Massnahmen das Schlaganfallrisiko um bis zu 80 Prozent gesenkt werden kann – ein beeindruckender Effekt.
Nach einem erlittenen Schlaganfall geht es zudem darum, die genaue Ursache zu identifizieren, um gezielt eine erneute Episode zu verhindern. Dazu zählen Untersuchungen auf Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern, die medikamentös behandelt werden können, sowie die Abklärung von verengten Halsschlagadern (Karotisstenosen), die in bestimmten Fällen operativ oder mittels Stent versorgt werden sollten.
Was passiert, wenn ein Schlaganfall nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird?
Wird ein Schlaganfall nicht rasch behandelt, kann das schwerwiegende Folgen haben: Etwa die Hälfte erholt sich dank des grossen Fortschritts in der Schlaganfallbehandlung und Nachsorge gut. Jedoch bleibt etwa ein Drittel dauerhaft beeinträchtigt und ca. 15 Prozent der Betroffenen verstirbt. Je früher die Behandlung beginnt – idealerweise innerhalb von viereinhalb Stunden –, desto besser sind die Chancen auf Erholung.
Besonders herausfordernd sind Schlaganfälle, die unbemerkt im Schlaf auftreten. Rund ein Viertel der Patientinnen und Patienten bemerken die Symptome erst am Morgen beim Aufwachen. Da die Zeit des letzten normalen Zustands – meist beim Zubettgehen – zählt, fallen viele formal aus dem Behandlungszeitfenster. Dank moderner Bildgebung kann heute aber oft unabhängig von der Uhrzeit beurteilt werden, ob noch rettbares Hirngewebe vorhanden ist. So können auch diese Patientinnen und Patienten von einer gezielten Therapie profitieren – ein grosser Fortschritt der letzten Jahre.
Gibt es neue Behandlungsansätze in der modernen Schlaganfallmedizin?
Ja, derzeit wird an vielen Innovationen gearbeitet, zum Beispiel an mobilen CT-Einheiten im Rettungswagen, an ferngesteuerten Kathetereingriffen oder auch an Blut- oder Bildbiomarkern zur weiteren Verbesserung der Diagnostik und Prävention. Auch die Entwicklung besserer Medikamente, etwa zur Reduktion von Entzündungsreaktionen im Gehirn oder zur Unterstützung der Neurorehabilitation sind spannende Felder.
Wie geht es nach einem Schlaganfall weiter? Welche Unterstützungsangebote gibt es für Betroffene und Angehörige?
Die Phase nach der Akutbehandlung ist für viele Betroffene besonders herausfordernd – körperlich, emotional und sozial. Deshalb gewinnt die Neurorehabilitation zunehmend an Bedeutung. Ziel ist es, die Selbstständigkeit zu fördern, die Lebensqualität zu verbessern und Betroffene wieder in den Alltag, die Familie oder ins Berufsleben zu integrieren.
Während die akute Schlaganfallbehandlung, die Sekundärprävention, die Neurorehabilitation und die medizinische Nachbetreuung bereits feste und etablierte Pfeiler der Schlaganfallkette sind, gewinnt nun auch das Thema «Life After Stroke» – das Leben nach dem Schlaganfall – zunehmend an Bedeutung. Der Bedarf an Ansprechpersonen und Unterstützungsangeboten hinsichtlich sozialer, psychologischer und alltagspraktischer Aspekte nach Abschluss der stationären Behandlung ist gross.
Hier setzen spezialisierte Patientenorganisationen und Netzwerke an. Die Schweizerische Herzstiftung bietet umfassende Informationen, Beratung und Unterstützung für Betroffene und Angehörige – von Broschüren bis zu Rehabilitationskursen. Ebenso engagiert ist der Verein FRAGILE Suisse, der sich auf die Begleitung von Menschen mit Schlaganfall und anderen Hirnverletzungen spezialisiert hat. Beide Organisationen bieten auch Selbsthilfegruppen und Peer-to-Peer-Programme an, bei denen Menschen mit ähnlicher Erfahrung wertvolle Unterstützung leisten – oft auf Augenhöhe und mit grossem Verständnis. FRAGILE Suisse hat vor Kurzem das Projekt LOTSE lanciert, welches Betroffene und Angehörige beim Übergang von der stationären Behandlung zur Nachsorge eng begleitet und unterstützt und so die Lücke zwischen stationärem und ambulanten Behandlungspfad schliesst.
Diese Angebote werden sehr gut angenommen, da viele Herausforderungen – von der Wiedereingliederung bis zu alltäglichen Problemen – gemeinsam besser bewältigt werden können. Bei den Nachkontrollen in den Ambulatorien der Stroke Units und Stroke Centers sowie in den Hausarztpraxen wird zunehmend darauf geachtet, Betroffene gezielt auf solche Angebote hinzuweisen und bei Bedarf aktiv zu vermitteln.
Haben sich die Schlaganfallzahlen in der Schweiz in den letzten Jahren verändert?
Ja, die absolute Anzahl an Schlaganfällen ist leicht gestiegen und liegt aktuell bei etwas mehr als 20’000 Schlaganfällen pro Jahr. Dies zum einen aufgrund der wachsenden und älter werdenden Bevölkerung, zum anderen auch aufgrund besserer diagnostischer Möglichkeiten und der Tatsache, dass mehr Betroffene ein spezialisiertes Spital erreichen und behandelt werden können.
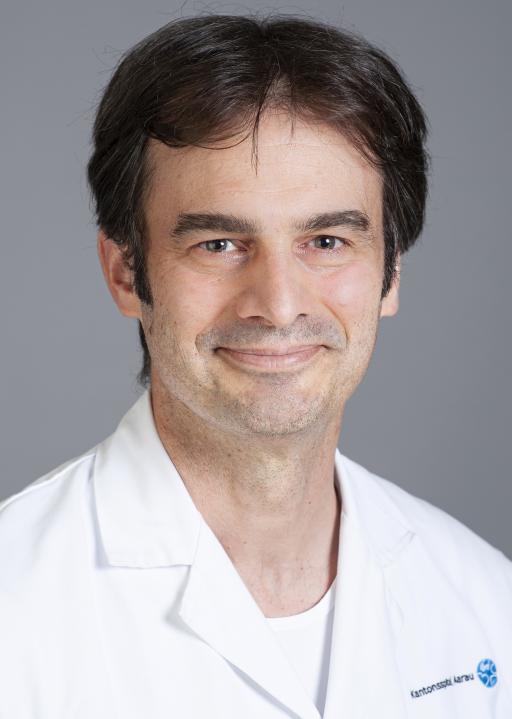
PD Dr. med. Timo Kahles, Kantonsspital Aarau AG
Leitender Arzt Neurologie
Co-Leiter Stroke Center



